Wasserstandsregelung
durch Pegelsonden
O.
Mitterfelner, Forstinning
 Druckversion als PDF Druckversion als PDF
|

Wasserkraft
& Energie
Nr.
3/2003
Verlag Moritz Schäfer
Paulinenstraße 43 .
32756 Detmold
|
|
Ich
erinnere mich noch an eine Regelung, die ca. 1960 eingebaut wurde, eine
Schwimmkammer von vielleicht 50 cm Durchmesser im frostsicheren
Turbinenhaus, über ein Rohr von ca. 1 cm Durchmesser mit dem Oberwasser
angeschlossen. Der Schwimmer in dieser Schwimmerkammer war über einen
Seilzug mit dem hydraulischen Regler verbunden, wo ein doppelt wirkender
Quecksilberschalter angebracht war. War der Pegel zu niedrig, zog das
Seil die Waage des Quecksilberschalters nach oben, das Quecksilber
schloss den Kontakt für Schließen, und die andere Seite der Waage
bewegte sich synchron mit dem Schließmechanismus auch nach oben; der
Quecksilberschalter öffnete wieder. – Ein simpler Mechanismus, ab und
zu musste man das Rohr von Schlamm und Algen reinigen.
Auch heute verrichten noch Regelungen mit
Schwimmern zuverlässig ihren Dienst, sogenannte Dreipunktregler, in der
Mitte ein neutraler Bereich, in dem nichts passiert, bei Pegelständen
unterhalb und oberhalb der Bereich für öffnen bzw. schließen. Zusätzlich
wird in der SPS dieses Signal noch getaktet, also z. B. wird 1 Sekunde
geöffnet bzw. geschlossen, dann 59 Sekunden gewartet. Denn der Pegel
verändert sich recht langsam, deshalb sind hektische Regelvorgänge
nicht sinnvoll. Auch hier gilt das Zitat eines Bekannten: „In der
Wasserkraft geht alles ganz langsam.“
Für die Messung
des Oberwasser-Pegels bei Wasserkraftwerken wird neben den erwähnten
Schwimmern, auch Pegelmesser nach dem Einperl-Prinzip, oder
Ultraschallgeräte eingesetzt. Immer mehr werden aber Pegelsonden
benutzt.
Pegelsonden haben gegenüber Einrichtungen mit
Schwimmern Vor- aber auch Nachteile:
+ Genaue Messung im Millimeter-Bereich
+ Robust und zuverlässig
+ Wartungsfrei
+ Über 4...20 mA Stromschleife direkt an SPS anschließbar
-- Teilweise recht teuer
-- Empfindlich gegen Blitzschlag
-- Empfindlich gegen starke Erschütterungen
-- Probleme mit Druckausgleich über Kapillarrohr
Wie funktioniert so eine Pegelsonde?
|
Pegelsonden bestehen aus einem wasserdichten Gehäuse
aus Edelstahl (V4A), ca. 20 mm Durchmesser. An der Oberseite ist ein
Kabel herausgeführt mit den Leitungen, meist 3, und dem Kapillarrohr für
den Druckausgleich, zu dem wir noch im Detail kommen. Der meist gelb-grüne
Draht ist der Schutzleiter, die beiden anderen Leitungen bilden die 4
... 20mA Stromschleife, wie sie standardmäßig verwendet wird.
An der
Unterseite ist eine dünne Membran aus Edelstahl oder auch Keramik, die
den eigentlichen Druck aufnimmt, und ihn an eine elektrische
Messeinrichtung weiterleitet. Häufig kann man unten noch ein Verlängerungs-Gewicht
anschrauben, damit die Pegelsonde zuverlässig in einer bestimmten
Position am Kabel hängt.
Abb. 1: Schema einer Pegelsonde
|
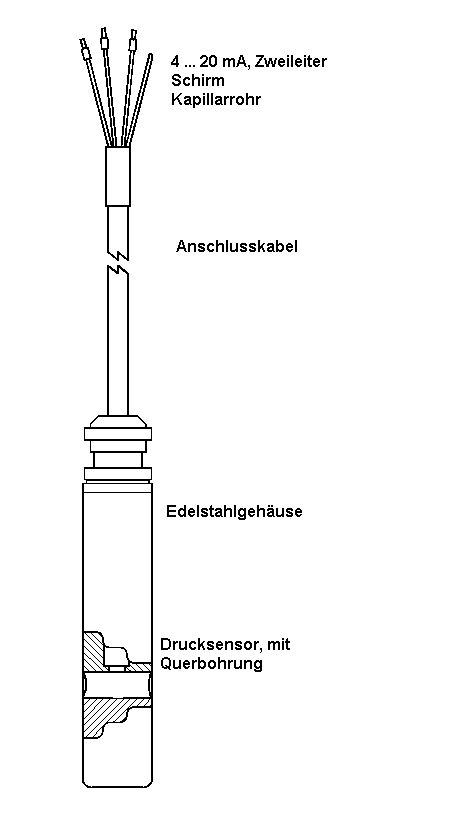
|
|
|
Die „empfindlichen“ Teile sind diese dünne
Membran, die innenliegende Elektrik, und das Kapillarrohr.
1. Die Membran ist natürlich sehr anfällig gegen alle Arten von Beschädigungen.
Mechanische Reinigungsversuche an diesem Teil sollte man unterlassen,
und – ganz wichtig – auch das Einfrieren der Sonde beschädigt diese
Membran so, dass die Sonde irgendetwas, aber nicht mehr den Pegel
anzeigt. Deshalb muss die Sonde so tief im Wasser montiert werden, dass
sie unter keinen Umständen einfrieren kann.
2. Die Elektrik ist eigentlich recht robust; falsche Polung bei der
Montage verursacht keine bleibenden Schäden, und auch kurzzeitige Überspannungen
bleiben ohne Folgen. Gegen einen massiven Blitzschlag ist aber jeder Überspannungsschutz
machtlos. Sehr starke Erschütterungen, wie z. B. fallen lassen zerstören
ebenfalls die Sonde.
3. Das Kapillarrohr ist sehr wichtig für die richtige Funktion, und Störungen
am diesem können zu merkwürdigen Effekten führen. Um den reinen
Wasserdruck messen zu können – und nicht den Luftdruck zusätzlich
– ist das Innere der Pegelsonde über das Kapillarrohr mit der Luft
oberhalb des Wassers verbunden, und alle Änderungen des Luftdrucks
haben deshalb keine Auswirkungen, solange das Kapillarrohr richtig
funktioniert. Der Luftdruck kann nämlich um +/- 50 mbar schwanken, was
einem Pegel von +/- 50 cm entsprechen würde.
Welche Fehler können
auftreten?
Das Kapillarrohr wird bei der Montage gequetscht, es tritt bei der
Montage oder im Betrieb Wasser in das Kapillarrohr ein, z. B.
Kondenswasser. Das Kapillarrohr endet in einer luftdichten
Installationsdose ohne Druckausgleich, oder winzige Tiere versuchen sich
in dem Kapillarrohr häuslich einzurichten. Einige Hersteller bieten
deshalb spezielle Kabeldosen mit Druckausgleich an, und auch
Schaumstoff-, Sinter- oder auch Teflon-Filter mit Trockensubstanz, die
zuverlässig alle
Verschmutzung und Luftfeuchtigkeit von dem
Kapillarrohr fernhalten.
Als
weiteres Zubehör sind Montagerohre bei den Herstellern erhältlich, um
die Pegelsonde geschützt gegen Treibgut an einer bestimmten Stelle im
Fluss zu halten. Diese Rohre sind in der Regel an der Unterseite
geschlossen, und besitzen Bohrungen, um den Wasserzufluss zu ermöglichen.
Diese Rohre schützen auch gegen Vandalismus, und Beschädigung aus Unwissenheit. In der Pegelsonde ist meist ein Überspannungsschutz
integriert, extern sollte zusätzlich eine Überspannungsschutz oder
Blitzschutz montiert sein.

Abb.
4: Sonde im Schutzrohr
Die Pegelsonden sollten in der Regel nicht am
untersten Ende des Schutzrohres angebracht werden, sondern einige
Zentimeter darüber, was man durch Abspannklemmen oder Verschraubungen
erreichen kann. Wichtig ist hierbei, dass bei einer Prüfung oder einem
Austausch die Pegelsonde wieder an der exakt gleichen Tiefe im Wasser
angebracht wird. Unbedingt beachtet werden muss, dass die Pegelsonde in
einem Bereich liegt, der unter keinen Umständen im Winter einfriert,
auch nicht bei Minimalpegel. Die Sonde sollte in dem Montagerohr so
angebracht sein, dass sie nicht durch die Strömung in dem Rohr taumelt
und ständig gegen die Wand schlägt.
|
|

Abb.
5: Sonde vor Reinigung |

Abb.
5: Sonde gereinigt |
Einige
Betreiber berichten, man muss die Pegelsonde regelmäßig von Schlamm
und Algen befreien; andere betreiben ihre Pegelsonde seit Jahren ohne
Reinigung. Findige Tüftler haben eine Vorrichtung installiert, um das
Sondenrohr ohne Ausbau der Pegelsonde von Schlamm zu reinigen; dazu wird
über ein separat angebrachtes Rohr von oben mit Hilfe eines
Wasserschlauchs gespült!
Druckaufnehmer
unterliegen einem Alterungseinfluss, der sogenannten Nullpunktdrift.
Genannt werden z. B. 0,1% pro Jahr. Das bedeutet, dass mit den Jahren
ein Messfehler entstehen kann, bei einer Sonde mit 250cm Messgröße
also bis zu 0,25 cm pro Jahr, was in der Regel zu vernachlässigen ist.
Daneben existiert noch ein Temperaturfehler, z. B. 0,2% je 10° Celsius,
was also bei dem obigen Beispiel etwa einem Unterschied zwischen Sommer
und Winter von 1 cm entspricht.
Die Pegelsonden werden meist an folgenden
drei Stellen
eingesetzt:
1. Oberwasserpegel vor dem Rechen, zur Messung und Regelung des
Sollpegels.
2. Oberwasserpegel, hinter dem Rechen; bei einer gewissen Differenz, z.
B. 3 cm wird automatisch der Rechen gereinigt, siehe Diagramm. Man
erkennt, dass am 06.09.2001, 18:00 bis 24:00 der Oberwasserpegel im
Bereich von +/- 2 cm geregelt wurde, dargestellt durch die obere Linie.
Der Pegel hinter dem Rechen fällt wegen Schmutz – verursacht durch
ein Gewitter - langsam ab, und steigt um 20.50 und 21.55 schlagartig
wieder an, wenn der Rechen gereinigt wurde. - Diese Auswertung wurde mit
Hilfe eines mobilen Analyse- und Diagnose-Systems erzeugt. Abb. 6
|
|
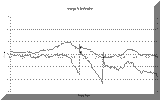
Abb.
6 Aufzeichnung des Wasserspiegels vor und hinter dem Rechen über sechs
Stunden
[Zum Vergrößern
auf das Bild klicken]
3. Unterwasserpegel: Er ist ein Maß für die aktuelle Wassermenge und
wird für die Optimierung der Leistung eingesetzt, z. B. Einstellung von
doppelt geregelten Kaplan-Turbinen, und auch den Spülvorgang.
Bei den Preisen besteht eine sehr große
Spannweite, so erhält man kostengünstige Pegelsonden schon ab ca. 200
€, spezielle Ausführungen können aber auch über 1.000 € kosten.
Die eingangs erwähnte Anlage befindet sich in
Niederbayern, im
mittleren Vilstal und wurde im Jahr 1996 modernisiert; es werden dort
drei Pegelsonden eingesetzt. Die Werte werden von einer PC-Steuerung
verarbeitet, und zur Steuerung von Rechen, Schleuse und Turbine
verwendet. – Verglichen mit dem damals eingesetzten Schwimmer eine
deutliche Verbesserung hinsichtlich Genauigkeit, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit.
www.srw-hydro.de
info@srw-hydro.de
Wasserkraft &
Energie 3/2003
|
|
|
|
| |